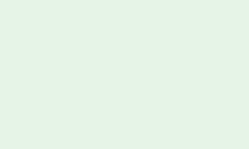So diagnostizieren wir eine Harninkontinenz bei Frauen

Um die Diagnose zu stellen, ist das genaue Erfragen der Beschwerden und der Krankengeschichte wichtig. Daneben stehen uns heute folgende Untersuchungsmethoden zur Verfügung:
Miktionstagebuch
Das sogenannte Miktionstagebuch (Miktion=Wasserlassen) dient der Erfassung der eingenommenen Trinkmenge, der gelassenen Urinmenge und des unwillkürlichen Harnverlustes. Die Patientin, der Patient trägt selbständig die Daten in das Tagebuch ein.
Klinische Untersuchung
Die Untersuchung wird bei gefüllter Blase im Liegen und Stehen durchgeführt. Zuerst beurteilt man die äusseren Geschlechtsorgane. Zusätzlich kann der Urinverlust durch die Harnröhre beim Husten festgestellt und eine evtl. vorhandene Beckenbodenschwäche mit Senkung der Gebärmutter, der Harnblase oder des Darms erkannt werden. Je nach Beschwerdebild wird noch eine Untersuchung der Nervenfunktion angeschlossen.
Vorlagen-Test (oder Pad-Test)
Mit diesem Test misst man die genaue Menge des verlorenen Urins. Über einen festgelegten Zeitraum (20 Minuten-oder 24 Stunden-Test) wird die Gewichtszunahme der getragenen Vorlagen gemessen. Die Patientin, der Patient sollte während dieser Zeit husten, niesen, Treppensteigen und sonstige Arbeiten ausführen, die normalerweise zum Harnverlust führen.
Wattestäbchen-Test (oder Q-Tip-Test)
Ziel dieser Untersuchung ist das quantitative Erfassen der Harnröhrenbeweglichkeit (urethrale Hypermobilität). Dabei wird ein steriles, angefeuchtetes Wattestäbchen in die Harnröhre eingeführt. Während die Patientin presst, misst man den veränderten Winkel, der durch das Pressen am Wattestäbchenende erreicht wird.
Bonney-Test
Dieser Test dient der Ergänzung des Wattestäbchentests. Bei nachgewiesenem Urinverlust beim Husten wird die Harnröhre stabilisiert und der Urinverlust beim Husten erneut beurteilt.
Endoskopie
Die Spiegelung von Harnröhre und Blase (Urethrozystoskopie) ist die beste Methode um Erkrankungen und andere Veränderungen zu erkennen. Dabei wird ein Endoskop (Optik) in die Blase eingeführt und das Bild mittels Kamera auf einen Monitor übertragen.
 |
Urinfluss- und Druckmessung in Harnröhre und Blase (Urodynamik)
Diese Untersuchungen ermöglichen die Erkennung der Ursachen sowie die Abgrenzung der verschiedenen Inkontinenzformen. Bei der Zystometrie wird der Blaseninnendruck während der Füllungsphase und während des Wasserlassens über einen speziellen Katheter gemessen. Dadurch kann sowohl die Speicher- als auch Entleerungsfunktion der Blase beurteilt werden. Die Aufzeichnung des Harnröhrendruckpofils ermittelt die Harnröhrenverschlussfunktion. Dabei wird eine Druckmesssonde in die Harnröhre und Blase eingeführt und der Druck in Ruhe und bei Bauchpresse oder Husten gemessen. Die Uroflowmetrie liefert Informationen über die Harnmenge, die pro Zeit während des Wasserlassens ausfliesst. Sie gibt Hinweise auf eine gestörte Blasenentleerung.
 |
 |
Bildgebende Verfahren
Mittels Ultraschall können wichtige Informationen über den Zustand innerer Organe getroffen werden. Im Zusammenhang mit Harninkontinenz sind die Erfassung des Restharns und die Ultraschalluntersuchung der Nieren empfehlenswert.
Die Ultraschalluntersuchung (Sonographie) dient der Darstellung der Blasenhalsbeweglichkeit. Sie kann als Ergänzung zur klinischen Untersuchung herangezogen werden. Der Ultraschallkopf wird auf den Bauch, den Damm oder auch an den Scheideneingang gehalten.
Das MRT (Magnetresonanzuntersuchung) gibt Auskunft über die Lage der verschiedenen Beckenorgane und kann auch die Bewegungen der Harnröhre und der Blase aufzeichnen. Diese Untersuchung ist nur bei speziellen Patienten erforderlich. Die Patientin liegt dabei in einer Magnetröhre, während das Bild der Unterbauchorgane durch das Gerät aufgezeichnet wird.
Wie geht es weiter?
Zwei Therapieformen stehen zur Auswahl
Wenn die Diagnose gestellt ist, bieten sich zwei unterschiedliche Optionen zur Behandlung an.
Aktuelles

Hotline
Sie suchen einen Facharzt in Ihrer Nähe? Rufen Sie uns an. Unsere Hotline hilft Ihnen gerne weiter.